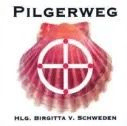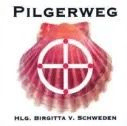Das Leben der Heiligen Birgitta
1303
Birgitta Birgersdotter wird im Jahr 1303 in eine der mächtigsten Familien Schwedens hineingeboren. Ihr Vater ist vorsitzender Richter in Uppland (der zu der Zeit bevölkerungsreichsten Gegend Schwedens an der Ostsee). Die Mutter ist verwandt mit dem herrschenden schwedischen Königsgeschlecht. Schon als Kind bekommt Birgitta Visionen und strebt ein Leben im Kloster an.
1316
Jedoch wird sie mit 13 Jahren mit Ademar Ulf Gudmarsson verheiratet. Ihr um fünf Jahre älterer Ehemann ist Landeshauptmann von der Provinz Närke und entstammt einem schwedischen Rittergeschlecht. Sie ziehen gemeinsam in die Burg von Ulvåsa in der historischen Provinz Östergötland am Ufer des Vätternsees. Ganz in der Nähe soll Birgitta später auch ihren Wirkkreis haben. Sie lebt über 20 Jahre mit ihrem Mann auf der Burg und bekommt in der
Zeit acht Kinder, vier Mädchen und vier Jungen. Zwei der Jungen sterben, einer mit zehn, der andere mit zwölf Jahren. Ihre Tochter Merete wird später die junge Königin Margarete I. am schwedischen Hof erziehen. Birgitta kümmert sich neben ihrer Mutterrolle um Frauen in der Umgebung, die aus unterschiedlichen Gründen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
1335
Nach knapp 20 Jahren auf der Burg wird Birgitta an den Königshof berufen. König Magnus Eriksson (oder Magnus II.) setzt Birgitta als Oberhofmeisterin ein. In dieser Funktion muss sie sich um seine Ehefrau Blanche von Namur kümmern. Unter anderem ist es ihre Aufgabe, der Belgierin schwedisch beizubringen.
1339
Mit ihrem Ehemann zusammen macht Birgitta ihre erste Pilgerreise. Sie wandern nach Nidaros, heute das norwegische Trondheim. Hier liegt im Nidarosdom Olav II. Haraldson, der Heilige Olav begraben, ein norwegischer König aus dem 11. Jahrhundert, dem Wunder und Legenden zugeschrieben werden. Außerdem versuchte Olav die Auseinandersetzungen in seinem Land zu befrieden.
1341
Nach ihrer Rückkehr verlässt Birgitta den Königshof und pilgert zwei Jahre später, wieder mit ihrem Mann zusammen, nach Santiago de Compostela. Dabei geraten sie mitten in die feindlichen Scharmützel des 100jährigen Krieges, der zwischen England und Frankreich tobt.
1344
Auf der Heimreise erkrankt Ulf. Sie bleiben gemeinsam in dem Zisterzienserkloster von Alvasta in der Provinz Östergötland, nur rund 25 Kilometer von Vadstena entfernt, von dem heute noch die Ruine zu sehen ist. Ulf stirbt 1344 und Birgitta bleibt noch weitere zwei Jahre in dem Kloster und schreibt erstmals die Offenbarungen, die sie empfängt, auf. Sie fühlt sich als „Braut Christi“ und als dessen Sprachrohr berufen. Gleichzeitig besucht sie immer wieder den königlichen Hof. Sie führt ein streng asketisches Leben.
1346
In einer ihrer Visionen erhält sie den Auftrag, eine neue Ordensgemeinschaft und ein Kloster zu gründen. König Magnus Eriksson überschreibt ihr das Gut Vadstena für das Kloster. Als Ratgeberin des Königshauses übt sie offen Kritik an dem verschwenderischen Lebensstil der Adeligen und selbst an dem des Königspaars.
1349
Gott wies Birgitta in einer Offenbarung den Weg nach Rom zum Papst, wo sich der Papst zu der Zeit aber gar nicht aufhält. Zwischen 1309 und 1377 lassen sich sieben Päpste hintereinander in Avignon krönen. Der Einfluss Frankreichs ist mächtig, immer mehr Kardinäle gehen aus dem Land hervor. Der erste französische Papst, Clemens V., siedelt nach seiner Wahl gar nicht erst nach Rom über, sondern bleibt zunächst in Lyon, dann zieht er nach Avignon. Zwei Jahrhunderte vorher kämpften die Päpste noch erbittert darum, von keiner Krone abhängig zu sein. Birgitta tritt dafür ein, dass der Papst zurück nach Rom kommt. Doch in Rom herrschen zu der Zeit, in der Birgitta dort ankommt, bürgerkriegsähnliche Zustände.
1350
Birgittas Tochter Katharina folgt ihrer Mutter nach Rom. Die beiden Frauen leben mit einigen ihrer Anhänger in einer klosterähnlichen Gemeinschaft an der heutigen Piazza Farnese. „Aus ihrer Vision erwuchs das außergewöhnliche Leben der Buße und Zurückgezogenheit, das sie in Italien während all der langen Jahre des Wartens auf die offizielle Anerkennung und die öffentliche Billigung ihres Plans führte.“ (Tore Nyberg in: Birgitta Atlas, Hrsg. Ulla Sander-Olsen, Tore Nyberg, Per Sloth Carlsen, Societas Birgitta). Birgitta unterhält eine Herberge für schwedische Pilger und Studenten. Gleichzeitig kümmert sie sich um Prostituierte. Der Ort an der Piazza Farnese gilt bis heute als das „Mutterhaus“ des Birgittenordens. Schon zu ihren Lebzeiten baute man an dem Platz die Kirche Santa Brigida. Der heutige Bau stammt aber aus dem frühen 15. Jahrhundert.
1352
Immer wieder unternimmt Birgitta selbst Pilgerreisen, so läuft sie 1352 in das rund 175 Kilometer nördlicher gelegene Assisi, dem Geburtsort des Heiligen Franziskus. Bei ihrer Pilgerreise nach Neapel im Jahr 1365 dürften auch politische Gründe eine Rolle gespielt haben: Gemeinsam mit ihrem Sohn Karl wohnt sie bei Johanna I. von Anjou, die gleichzeitig Königin von Neapel, Sizilien und Jerusalem ist. Das mächtige Geschlecht Anjou besitzt zu der Zeit außerdem Avignon, den Sitz der Päpste. Doch Johannas Macht sinkt, statt ihren Einfluss geltend zu machen, verliebt sich die zweifache Witwe in den Sohn von Birgitta.
1367
Nach ihrer Rückkehr kehrt auch der amtierende Papst Urban V. nach Rom zurück. Über drei Jahre gibt es mehrere Begegnungen von Birgitta und dem Papst. Sie bittet ihn um die Erlaubnis, ein Kloster nach neuen Ordensregeln gründen zu dürfen. Doch der Papst erhört sie nicht.
1370
Unverständnis erntet Papst Urban V. bei vielen Christen – so auch bei Birgitta – als er sich erneut auf den Weg nach Avignon macht. Birgitta eilt ihm nach und holt ihn im nördlicher gelegenen Montefiascone ein. Sie erlangt die Erlaubnis, einen Konvent gründen zu dürfen, jedoch nicht nach ihren eigenen Ordensregeln. Aber: „Das ebnete den Weg für die notwendigen Bauarbeiten an dem Herrenhaus in Vadstena, einem alten Backsteinbau. Die Hauptgebäude des Gutes mussten an die Bedürfnisse einer Gemeinschaft von bis zu 60 Nonnen angepasst werden. Ebenso wie andere, nahegelegene Gebäude für eine Gemeinschaft von bis zu 25 Priestern und Laien einzurichten waren, die mit dem Nonnenkloster in Verbindung stehen sollten.“ (Tore Nyberg, ebenda). Das Kloster im schwedischen Vadstena wird gebaut und Birgitta bleibt in Rom.
1372
Als 69-Jährige begibt sich Birgitta mit ihren Kindern Katharina, Birger und Karl auf ihre letzte Pilgerreise ins Heilige Land. Sie lassen sich nach Zypern übersetzen und wohnen am Hof von Eleonore von Aragon, der Königin von Zypern. Birgitta wird ihre Ratgeberin, wie sie schon einige Königinnen vor ihr beraten hat.
1373
Birgitta stirbt am 23. Juli 1373 in ihrem Haus an der Piazza Farnese. Erst fünf Jahre nach ihrem Tod erkennt der nächste Papst, Urban VI., den Doppelorden in Vadstena samt dessen Ordensregeln an. „Einige Auffassungen des frühen 14. Jahrhunderts von einem religiösen Leben in gemeinschaftlicher Armut, Keuschheit und Gehorsam deckten sich und verschmolzen mit der neuen Vorstellung klösterlichen Lebens.“ (Tore Nyberg, ebenda).
1391
Papst Bonifatius IX. spricht Birgitta von Schweden 18 Jahre nach ihrem Tod heilig. 1991 wird sie zusammen mit Katharina von Siena und Edith Stein zur Patronin Europas ernannt. „Frau Birgitta (1303 bis 1373), schon als Tochter des schwedischen Rechtssprechers Birger Persson eine einflussreiche Gestalt, zählte mit ihrem Gatten Ulf Gudmarsson zu jenen Persönlichkeiten des 14. Jahrhunderts, welche die außerordentliche Bedeutung geistlicher Inspiration für die geordnete Ausgestaltung christlichen Rechtes und christlicher Religion erkannten.“ (Tore Nyberg, ebenda).